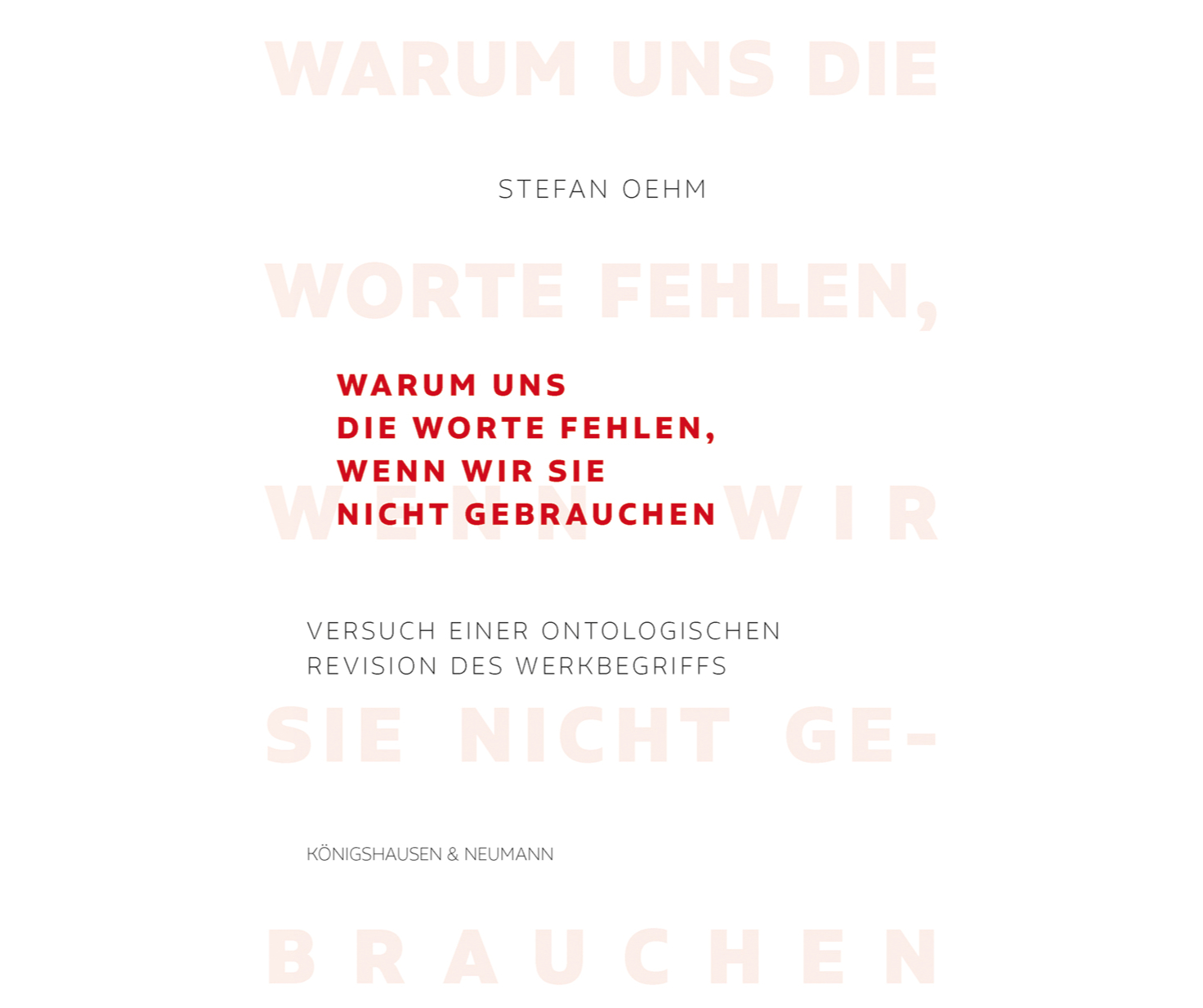Im Kunstdiskurs sind wir gefangen in unserer notorisch dinghaften Weltkonzeption. Kein Wunder, dass wir deshalb fast schon zwangsläufig bei dem Versuch scheitern müssen, sprachlich verfasste Werke ontologisch adäquat zu bestimmen. Triviale Schlussfolgerungen werden nicht gezogen. Animistische Redeweisen gaukeln präzise Beschreibungen vor. Weder die Annahme, Nichtexistentes könne Existentes determinieren, noch die, Abstrakta seien Konkreta vorgängig, löst verständnisloses Kopfschütteln aus.
In seinem neuen Buch Warum uns die Worte fehlen, wenn wir sie nicht gebrauchen, das ab Ende Oktober im Buchhandel erhältlich sein wird, bemüht sich Stefan Oehm im Rahmen einer ontologischen Revision des Werkbegriffs um eine konsequente Vermeidung solcher und ähnlicher Inkonsistenzen. Dazu gehört auch eine systematische Differenzierung der verschiedenen Aggregatzustände dessen, was uniform Werk genannt wird.
Dabei setzt er sich mit relevanten kunstphilosophischen Positionen, insbesondere der typentheoretischen Kunstontologie auseinander, reflektiert das Konzept der Performanz, das auf den Sprechakttheoretiker John L. Austin zurückgeht, ebenso wie das der Konstitution institutioneller Tatsachen von John R. Searle. Gleiches gilt für die unsere Kommunikation bestimmende Idealisierung der Reziprozität der Perspektiven (Alfred Schütz) wie auch für Wilhelm von Humboldts wegweisende gebrauchstheoretische Konzeption der Sprache als einer ‚Thätigkeit‘, die uns geradewegs zu der These führt: Sprachlich verfasste Resultate künstlerischen Schaffens sind transitorische Ereignisse, sie existieren allein im Gebrauch, durch den Gebrauch und während des Gebrauchs durch uns. Sonst nicht.